Meditation über 1. Mose, 1,1-2
Theologie light und der Urknall
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.
von Eberhard le Coutre
Dieser Holzstich ist erstmals zu finden in dem Buch L'atmosphère, météorolgie populaireParis 1888, S. 163 des seinerzeit sehr bekannten und als Schriftsteller sowie als
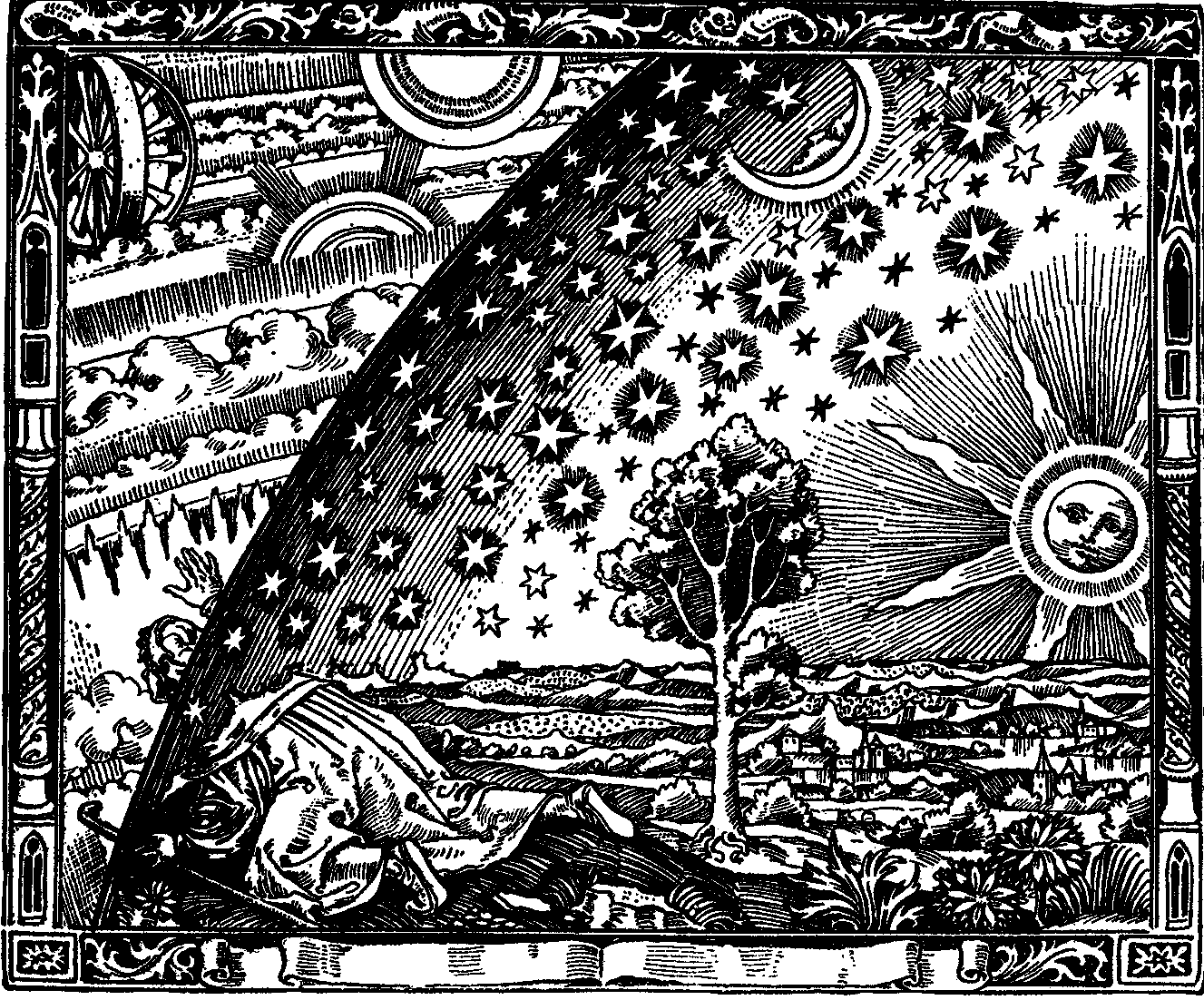 |
Anfang, Schöpfung, Gott, Himmel, Erde - jedes Wort im ersten Satz der Bibel ein zentrales Thema der Menschheitsgeschichte. Über jeden Begriff sind Bücherschränke, - ach was, Bibliotheken vollgeschrieben worden. Jeder Begriff war aber auch schon ein Thema ehe es Schriften und fixierte Traditionen gab.
Bereits mit dem ersten Wort haben Theologen ihre Probleme. Ist "Am" oder "Im" die richtige Kombination aus Präposition und Artikel? In den meisten christlichen Übersetzungen heißt es "Am Anfang...". Die bekanntesten jüdischen Übersetzer der Hebräischen Bibel ins Deutsche, Martin Buber und Franz Rosenzweig, schreiben: "Im Anfang...". Das sind keine Marotten interpretationswütiger Deutungsfanatiker. "Am" Anfang, das kann man etwa so verstehen: Zunächst war da nichts (oder: das Nichts? - auch das eine Bücherschränke füllende Detailfrage), aber irgendwann fing der Schöpfer an, etwas (oder soll ich lieber schreiben: das Etwas?) zu erschaffen, und zwar beginnend mit Himmel und Erde. Dieser Anfang führte - wie ab Vers 2 nachzulesen - zunächst zu einem Zustand, der als "wüst und leer" (Hebräisch: Tohuwabohu; Buber/Rosenzweig: Irrsal und Wirrsal) zu beschreiben war. "Im" Anfang dagegen, das klingt schon komplizierter. Man könnte dabei daran denken, dass es einen - räumlich?, zeitlich?, sowohl räumlich als auch zeitlich? - vorfindlichen Zustand gab, der "Anfang" genannt werden kann, - ein Zustand, den Gott als der Schöpfer quasi als Herausforderung begriff und in den er sich - kreativ, also schöpferisch - eingemischt hat.
Es geht hier nicht um Glasperlenspiele. Was ich unter "Schöpfung" verstehen kann, das hat unmittelbar etwas zu tun mit der Hoffnung, die stärker ist als der Tod. Also: Welche Vorstellung von Ewigkeit kann, darf, muss sich machen, wer festhalten will am Glauben an das ewige Leben, - eine Hoffnung, zu der sich die Christen aller Konfessionen im letzten Satz ihres Glaubenszeugnisses gemeinsam bekennen. Wer genauer betrachtet, womit sich die Kirchen hierzulande gegenwärtig besonders aufgeregt und aufmerksam beschäftigen, gewinnt allerdings nicht den Eindruck, dass es sich bei dieser Frage um ein vorrangiges Thema für Kirchenleitungen, Synoden, Pfarrkonvente, Kirchentage und sonstige Öffentlichkeits- und Bildungsveranstaltungen der Kirchen handelt.
Im Gegenteil: Das große Thema Schöpfung wird in den Kirchen zur Zeit heruntergeschraubt auf die Ebene von Ökologie, Verbraucherschutz und - ganz wichtig - Wellness; Schöpfung ist, was auf unserem kleinen Globus gegenwärtig passiert und was möglichst lange mindestens so gut bleiben soll, wie es ist. Man hat sich im schlichten Milieu wohlfeiler political correctness publikumswirksam etabliert. Worum es wirklich geht, wird kaum diskutiert, geschweige denn öffentlichkeitswirksam thematisiert.
Ein paar Anmerkungen zu den Hintergründen: Man kann die Schöpfungsgeschichten der Bibel als naturwissenschaftliche Berichte über die Entstehung der Welt und des Lebens auf der Erde lesen. Wer jedoch mit Adam und Eva gegen Darwin zu Felde zieht, gilt inzwischen zu Recht als hinterwäldlerischer Fundamentalist. Mindestens in den großen Kirchen, wo man seriöse Theologie betreibt, wird so nicht mehr argumentiert. Der biblische Schöpfungsglaube betont die Zusammengehörigkeit unserer Erde und der darauf Lebenden mit dem gesamten Kosmos, mit allem also, was sonst noch geschaffen worden ist. Unter dem Begriff Evolution hingegen wird die Entstehung des Lebens, die Entwicklung der Geschöpfe und Arten auf dem Planeten Erde erforscht und diskutiert. Das heißt, hinsichtlich der Anfänge werden biblischer Schöpfungsglaube und moderne Naturwissenschaft nicht mehr als unversöhnliche Widersprüche angesehen.
Was jedoch das Ende der uns vertrauten Welt anbetrifft, ist eine vergleichbare Verträglichkeit von Glauben und Verstehen noch nicht Allgemeingut in den Kirchen geworden. Das lässt sich anhand von ein paar Zahlen erläutern: Die Sonne gibt es seit etwa fünf Milliarden Jahren, unseren Globus seit etwa vier Milliarden Jahren. Etwa sieben Milliarden Jahre können als weitere Dauer für unsere Sonne angenommen werden. Zwölf Milliarden Jahre, das Alter unserer unmittelbaren kosmischen Umgebung - eine unvorstellbar lange Zeit. Aber Gottes Ewigkeit wird davon noch nicht - sagen wir mal - nennenswert berührt. Gottes Ewigkeit, und damit auch die Zukunft, in die sich die Hoffnungen der Glaubenden erstrecken, ist etwas Anderes als lediglich eine ins Unendliche verlängerte Zeitachse nach dem Schema unserer Fahrpläne und Kalender. Über die schwierigen Beziehungen zwischen Zeit und Ewigkeit wird heutzutage allerdings bei Naturwissenschaftlern und Mathematikern intensiver nachgedacht und diskutiert als in den Kirchen.
Die heutigen Menschen und deren direkte, aufrecht gehenden Vorfahren gibt es seit etwa zwei bis drei Millionen Jahren. So lange, bis die Sonne ihre Funktion als Energiespender für jegliches Leben aufgeben wird, wird unsere Erde aber nach allem, was wir heute wissen, kein Lebensraum für Menschen mehr sein können. Wenn in den Kirchen inzwischen ein modernes Weltbild angekommen wäre und beispielsweise auch mittels kritischer Vernunftanwendung darüber nachgedacht würde, welche "Wende" wirklich als eine kopernikanische bezeichnet zu werden verdient, wüssten auch Kirchenleute inzwischen, dass die Zeit der Menschen eine Episode innerhalb der großen Ewigkeit des großen Schöpfergottes ist, des Gottes also, den Juden mit guten Gründen viel häufiger als die Christen den Ewigen nennen. Schon sehr, sehr lange vor den Menschen gab es Leben auf der Erde und es gibt Grund zu der Erwartung, dass es auch nach den Menschen noch Leben auf unserem Globus und nach dem Vergehen unseres Sonnensystems weiterhin Leben in der von Gott geschaffenen Welt geben wird.
Einer der ersten christlichen Theologen der beginnenden Neuzeit, der über diese Probleme tiefer als heute üblich nachgedacht hat und zutiefst von ihnen bewegt wurde, war Johann Rist (1607 - 1667), der 1642 ein Kirchenlied schrieb mit folgenden Versen am Anfang (Evangelisches Kirchengesangbuch - EKG - Nr. 324, in der EKD in Gebrauch bis 1994):
O Ewigkeit, du Donnerwort / o Schwert, das durch die Seele bohrt / o Anfang sonder Ende! / O Ewigkeit, Zeit ohne Zeit / ich weiß vor großer Traurigkeit / nicht, wo ich mich hinwende.
Kein Unglück ist in aller Welt, / das endlich mit der Zeit nicht fällt / und ganz wird aufgehoben. / Die Ewigkeit nur hat kein Ziel, / sie treibet fort und fort ihr Spiel, / läßt nimmer ab zu toben.
Interessant an diesem Lied ist heute vor allem, dass es 1994, also rund 350 Jahre nach seinem Entstehen, aus dem in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) neu eingeführten Evangelischen Gesangbuch (EG) entfernt wurde. Immerhin handelt es sich um einen Choral, der zweimal Thema für eine Bachkantate wurde (zum 1. Sonntag nach Trinitatis, 11. Juni 1724 - BWV 20 und "Dialogus" zum 24. Sonntag nach Trinitatis, 7. November 1723 - BWV 60).
Zugleich mit dem Lied von Johann Rist wurde übrigens ein rund 50 Jahre später entstandenes Kampflied dagegen von Kaspar Heunisch (1620 - 1690), das eine diametral entgegengesetzte Stimmung wortreich entfaltet, aus dem EKG (Nr. 325) gestrichen, es kann nach der gleichen Melodie gesungen werden, und es beginnt so:
O Ewigkeit, du Freudenwort / das mich erquicket fort und fort / o Anfang sonder Ende! / O Ewigkeit, Freud ohne Leid / ich weiß vor Herzensfröhlichkeit gar nichts mehr vom Elende / weil mir versüßt die Ewigkeit / was uns betrübet in der Zeit.
Wer weiß schon, was sich Gesangbuchreformierer gedacht haben, die eine so eindrucksvoll dokumentierte und nach wie vor hoch aktuelle theologische Kontroverse aus dem Gesangbuch rausgeschmissen haben? Was auch immer - so schwierige Unterscheidungen wie die zwischen Ewigkeit und Zeit oder zwischen unserer vertrauten Erde und dem großen Kosmos wollen heutige Kirchenleitungen ihren Gemeinden und einer von ihnen verordneten zeitgenössischen Frömmigkeit offensichtlich denn lieber doch nicht mehr zumuten. Die sich zur Zeit ausbreitende und kirchenamtlich geförderte Theologie light für stetig nachgefragte religiöse Behaglichkeit singt zum Beispiel lieber "Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe, wie Wind und Wiesen - ewiges Daheim" (EG, Ausgabe Nordelbien1994, Nr. 622,4). Das "ewige Daheim" - vorgestellt wie die gewohnten Wetterverhältnisse und die vertrauten Naherholungsgebiete unmittelbar vor der eigenen Haustür, gleich hinterm Deich - das beruhigt, das konserviert hausbackene Tradition und das bewahrt geistliche Amtsträger vor unbequemen Fragen.
Dass auch Urknall und schwarze Löcher, Milchstraßen, Lichtjahre, Kometen samt ihren Schweifen und vagabundierende Asteroiden, Antimaterie und Gegenwelten, gigantische Explosionen und Implosionen Teil haben an Gottes Schöpfung und Seiner Verheißung von Ewigkeit - das alles bleibt also einstweilen besser ausgeklammert aus Gesangbüchern und Katechismen. Das große Welttheater mit den Hauptdarstellern Der Schöpfer und Seine Ebenbilder bleibt reduziert auf ein temporäres Guckkastenspiel von wenigen Millionen Jahren, und gespielt wird auf einem klerikal heimelig eingehegten Hinterhof, der von den geistlich geführten Schäflein für die gesamte Welt gehalten werden darf. Die Methoden haben sich erfreulicherweise deutlich humanisiert, aber sind die von der Inquisition angestrebten meinungsbildenden Absichten und Wirkungen über Anfang und Ende der Welt seit den Zeiten von Giordano Bruno (1548 - 1600) oder - nicht mehr so brutal - Galileo Galilei (1564 - 1642) letztlich wirklich vernünftiger geworden und damit zugleich auch menschlicher?
Bleibt festzustellen: Eine Kirche, die keine interessanten, intellektuell anspruchsvollen und existentiell bedenkenswerten Erwägungen, Visionen, Hoffnungen über Zeit und Ewigkeit anzubieten hat, in denen aufgegriffen wird, was die moderne Naturwissenschaft über inzwischen erkennbar gewordene zeitliche und räumliche Dimensionen von Sein und Zeit zu sagen hat, verfehlt ihr Thema. Wenn überhaupt etwas, dann haben moderne Menschen von Theologen und deren Einsichten vermittelnden Kirchen verbindliche Bemühungen zu erwarten um Antwort auf die folgende Frage: Wie kann Hoffnung möglich sein auf bleibende Bewahrung und Spuren individueller Geborgenheit für das Leben und für die Lebenden angesichts permanenter kosmologischer Umwälzungen, Veränderungen, Entwicklungen und Neuerungen, welche die Gesamtheit des Seins, das wir als Glaubende Schöpfung nennen, charakterisieren? Wenn es dazu keine glaubwürdigen - also: eines ehrlichen Glaubens würdigen - Botschaften von Christen und Kirchen mehr gibt, dann bleibt alles weitere Reden über Schöpfung und Bewahrung derselben unverbindliches Geschwätz; der letzte Satz aus dem Glaubensbekenntnis "...und das ewige Leben" ist dann zur leeren Begriffshülse geworden.
Merke: Für die Alten gab es zwischen Himmel und Erde noch einen vom Begriff Schöpfung ausgehenden notwendigen Zusammenhang. Dieser Zusammenhang ist in unseren Kirchen - hoffentlich nur vorübergehend - weitgehend abhanden gekommen. Vorstellungen über den Anfang des Lebens auf unserer Erde sind inzwischen - mühsam genug - entmythologisiert worden. Was das Ende der Welt betrifft, hält auch die heutige evangelische Kirche indessen unkritisch an alten Mythen fest und - was schlimmer ist - begünstigt das Entstehen simplifizierender und langweiliger neuer Verschleierungen.
Wie gesagt, die Generationen der Glaubenden vor uns sind so oberflächlich nicht umgegangen mit der Zuordnung von Himmel und Erde und von Zeit und Ewigkeit. Spätestens von Johann Rist könnten wir lernen: Heute wissen wir zwar mehr - aber früher waren wir schon mal klüger.
aus: der überblick 01/2002, Seite 101
AUTOR(EN):
Eberhard le Coutre:
Eberhard le Coutre ist ehemaliger Chefredakteur des "überblicks" und lebt jetzt im Ruhestand.